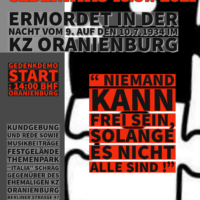Günter Morsch ist 68 Jahre alt, aber er sieht jünger aus. Er hat eine kräftige Statur, Vollbart und trägt eine Hornbrille. Der Historiker hat die Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen geleitet. Nun ist er in Rente und könnte seinen Ruhestand genießen, doch da ist noch etwas.
Günter Morsch stand auf einer der Listen des NSU, auf denen die Terroristen um Beate Zschäpe aufgeschrieben hatten, wer in ihr Zielraster passte, wen sie töten wollten oder zumindest ins Auge gefasst hatten: Türken, sozial engagierte Menschen – und eben Günter Morsch.
Bis zur E‑Mail aus dem Reporterteam von CORRECTIV hat niemand mit ihm darüber geredet, dass er ein mögliches Opfer der Rechtsterroristen war. Günter Morsch wusste nichts. Niemand hat ihm Bescheid gesagt, mit ihm geredet. Und das beschäftigt ihn.
„Angesichts der guten Zusammenarbeit mit der Polizei in meiner Zeit als Gedenkstättenleiter und Stiftungsdirektor war ich wirklich enttäuscht“, sagt Morsch. Das tut weh. Die guten Kontakte zu den Behörden waren ein wichtiger Bestandteil seiner Arbeit, sagt Historiker Morsch. Immer wieder war Rechtsextremismus sein Thema. Von 1993 bis 2018 leitete er die „Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen“ in Brandenburg. Jährlich kommen rund 700.000 Menschen hierher. Ab 1997 war Morsch als Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten (SBG) zusätzlich für vier weitere Orte verantwortlich.
Ursprünglich kommt Morsch aus dem Saarland, das hört man heute noch. Er kam sieben Jahre nach Kriegsende auf die Welt. „Wir sind in der Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit groß geworden, das prägte meine Jugend stark“, sagt Morsch. In seiner Gemeinde lebten damals rund 2.000 Leute, zu verstecken gab es da nicht viel: „Anders als in einer Großstadt sind in einem überschaubaren Dorf, in dem jeder jeden kennt, die Anhänger und Träger der NS-Bewegung und des NS-Staates auch viele Jahre später noch namentlich bekannt.“ Es war selbstverständlich, dass der Bürgermeister früher bei der NSDAP war und die lokalen Eliten bei SA, SS und anderen Organisationen, sagt Morsch. Die meisten hätten sich damit arrangiert, eine Auseinandersetzung damit sei immer eine Sache von Minderheiten gewesen. „Von daher war man immer das, was man bis heute Nestbeschmutzer nennt.“ Der Streit um die NS-Vergangenheit sei deshalb leider nicht immer nur mündlich, sondern „vereinzelt auch physisch“ ausgetragen worden.
Später studierte er in Berlin, arbeitete an historischen Ausstellungen mit und war Referent für Erwachsenenbildung. Dann verbrachte er fünf Jahre am Industriemuseum im nordrhein-westfälischen Oberhausen. Als Historiker und Ausstellungsmacher, der sich viel mit dem Nationalsozialismus beschäftigt hatte, kam er schließlich zum früheren „Konzentrationslager bei der Reichshauptstadt“, wie Sachsenhausen zur NS-Zeit genannt wurde.
Morsch betont immer wieder, wie hervorragend in seinen Augen seine Kooperation als Gedenkstättenleiter nicht nur mit Politik und Landeskriminalamt (LKA), sondern auch mit dem Verfassungsschutz lief. Und das, obwohl gerade das Landesamt in Brandenburg im Zusammenhang mit dem NSU besonders in der Kritik steht, da es die Festnahme von Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt behindert haben soll. Als die Thüringer Polizei die drei 1998 per Haftbefehl suchte, verweigerten ihr die brandenburgischen Verfassungsschützer Informationen zu einem V‑Mann aus dem NSU-Umfeld, der die Ermittler zum Aufenthaltsort des Trios hätte führen können.
Als Morsch von dem Eintrag mit seinem Namen erfuhr, schrieb er einen Brief an den Innenminister von Brandenburg, Michael Stübgen (CDU). Ein persönlicher Referent antwortete innerhalb weniger Tage, kurz darauf auch jemand von der Polizei: Wir kümmern uns, hieß es. Einige Wochen später wollen zwei Beamte vom Bundeskriminalamt (BKA) aus Meckenheim in Nordrhein-Westfalen anreisen, um mit ihm in der Polizeihochschule in Oranienburg zu sprechen. Es sind einige Wochen des Wartens, des Nachdenkens.
Schon einmal war Morsch auf einer Feindesliste, Anfang der Nullerjahre bei „Altermedia“: ein internationales Neonazi-Portal, das 2016 verboten wurde. „Wenn der Name ‚Morsch‘ fällt, geht das Messer in der Tasche auf“, hieß es dort über ihn. Auch über diesen Eintrag wurde Morsch nie informiert, er entdeckte ihn selbst. Weil er wusste, dass er für Rechtsextreme eine exponierte Figur war, suchte er früher systematisch nach seinem Namen im Internet. Angst hatte er nie, sagt er, auch besondere Sicherheitsvorkehrungen traf er nicht: Kein Name auf dem Klingelschild, keine Nummer im Telefonbuch – das war‘s.
Günter Morsch hat viel erlebt in seinen mehr als 25 Jahren als Leiter der Gedenkstätte im 1936 errichteten Sachsenhausen. SS-Chef Heinrich Himmler nannte es ein „vollkommen neues, jederzeit erweiterungsfähiges, modernes und neuzeitliches Konzentrationslager“. Mehr als 20.000 Menschen kamen dort bis Kriegsende ums Leben. Von 1945 bis 1950 diente es dann als sowjetisches Speziallager. Dort waren rund 60.000 Menschen inhaftiert, vor allem „untere und mittlere NS-Funktionäre“. Circa 12.000 von ihnen starben in den fünf Jahren, vor allem an Hunger und Krankheiten, Anfang der 90er wurden Massengräber entdeckt. An den Gräbern der Häftlinge kam es später zu Veranstaltungen mit Hakenkreuzen und Hitlergrüßen. Neonazis versuchten, Lager und Opfer für nationalsozialistische Propaganda zu instrumentalisieren. Seitens der Opferverbände gab es kaum Widerstand, erzählt Morsch. Im Gegenteil, sie hätten die Totenzahlen übertrieben, wissenschaftliche Erkenntnisse über die Geschichte des Speziallagers bestritten und manche Personen aus dem Vorstand von Verbänden hätten sogar die Existenz von Gaskammern in Zweifel gezogen. Er vermutet, dass es diese permanente Auseinandersetzung um die Geschichte war, die ihn zur Zielscheibe von Rechtsextremen machte.
„Wir haben vor allem in den 90er Jahren in der Stadt und in den Gedenkstätten Brandenburgs fast die gesamte Palette an rechtsextremen, rassistischen und antisemitischen Aktivitäten erfahren müssen“, sagt er. Im Herbst 1992 zündeten zwei Neonazis eine Baracke an, in der früher Juden inhaftiert waren. Praktisch genau zehn Jahre nach der Tat fand ein weiterer Brandanschlag statt, diesmal auf die KZ–Gedenkstätte im Belower Wald, für die Morsch ebenfalls verantwortlich war. Auf eine Erinnerungsstele sprühten die Täter SS-Runen und ein Hakenkreuz, daneben schrieben sie: „Juden haben kurze Beine.“ Auch andere Gedenktafeln in Brandenburg wurden immer wieder beschädigt. Insgesamt seien die Angriffe seit Ende der 90er Jahre aber deutlich zurückgegangen, sagt Morsch. Zwei Aspekte seien damals entscheidend gewesen und auch heute noch wichtig beim Kampf gegen Rechtsextremismus: die Herausbildung einer „Bürgergesellschaft“, die sich deutlich positioniert – und eine entschiedene Politik des Staates.
Als Morsch in Oranienburg anfing, war die Stadt ein Neonazi-Hotspot. So steht es im Bericht des Verfassungsschutzes. Bürgermeister hätten das Problem anfangs nicht wahrhaben wollen. Das änderte sich irgendwann: „Entscheidend war, dass die Menschen anerkannten, dass die Neonazis zum Teil ihre eigenen Kinder sind und dass es sich um ein strukturelles Problem handelt, das man nicht einfach irgendwohin abschieben kann.“ Auch Polizei und Justiz seien entschieden gegen Rechtsextremismus vorgegangen. Zum Ende seiner Amtszeit hin habe es dann keine nennenswerten Skandale mehr gegeben – mit Ausnahme einer Besuchergruppe, die 2018 auf Einladung von AfD-Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel in der Region war. Sie wurden wegen Störungen der Gedenkstätte verwiesen, ein Mann zweifelte die Existenz von Gaskammern an und wurde später zu einer Geldstrafe von 4.000 Euro wegen Volksverhetzung und Störung der Totenruhe verurteilt.
Heute sei für ihn das Beunruhigendste, wenn der Staat von Rechtsextremen durchsetzt werde. „Jeder Vorfall, der belegt, dass der Staat und die Gesellschaft auf dem rechten Auge schwächer sehen oder blind sind, ist eine ernsthafte Bedrohung für die Demokratie“, sagt Morsch hinsichtlich der aktuellen Entwicklungen in der Bundeswehr, der Polizei und der Justiz. Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus würden unterschätzt. „Es erbost mich immer wieder, wenn ich zu sehen glaube, dass es offensichtlich erst durch den Mord an einem bedeutenden Politiker ein wirkliches Umdenken in maßgeblichen Teilen unseres Staates und der Gesellschaft gegeben hat“, sagt Morsch. Er macht sich Sorgen, ist aber auch Optimist: „Ich vertraue den Regeln der Demokratie und des Rechtsstaates und darauf, dass die In-
strumente, die wir zur Verfügung haben, wenn wir sie denn auch nutzen und ausschöpfen, zu einem positiven Ergebnis letztlich führen.“
Morsch befürwortet eine Weiterbildungspflicht für Bedienstete in öffentlichen Stellen, etwa Polizei, Justiz, Bundeswehr. Wer in den höheren Dienst der Polizei in Brandenburg will, beschäftigt sich in der Regel mit der Geschichte der Polizei im NS-Staat – in Kooperation mit der Gedenkstätte. Das Projekt sei damals ein Pionierprojekt gewesen, heute werde Ähnliches in mehreren Bundesländern gemacht. „Solange unsere Gesellschaft mit Minderheiten so umgeht, wie sie es tut, so lange bleibt auch die Geschichte des Nationalsozialismus aktuell“, sagt Morsch. Als Lehrbeauftragter zu NS-Themen an der Freien Universität in Berlin leistet er auch in der Rente noch immer seinen Beitrag dazu.
Wie angekündigt treffen sich im Herbst zwei BKA-Beamte mit Morsch, um über seinen Namen auf der Feindesliste zu sprechen. Zwei LKA-Beamte sind bei dem Gespräch in der Polizeihochschule Oranienburg ebenfalls dabei.
„Ich habe das Treffen als sehr nützlich und aufschlussreich empfunden und bin nun doch einigermaßen beruhigt“, sagt Morsch. Die Beamten hätten für ihn überzeugend dargelegt, dass die aus verschiedenen Dokumenten bestehende Sammlung von Namen noch keine „Todesliste“ darstelle, wie das häufig berichtet worden sei. Die Beamten hielten eine Weiterverwendung der vom NSU angelegten Datensammlungen in der rechtsextremen Szene für höchst unwahrscheinlich. Morsch zufolge sagten die Behördenvertreter zudem, das Kreuz hinter seinem Namen habe keine Hervorhebung bedeutet, „sondern eher im Gegenteil“. Schließlich habe der NSU sich entschieden, in erster Linie Migranten zu töten, daher sei die handschriftliche Notierung seines Namens, mutmaßlich durch Uwe Böhnhardt, ohne Konsequenzen geblieben, ein Anschlag nicht ernsthaft erwogen worden.
Über die Vergangenheit Bescheid zu wissen, sei heute noch hilfreich, sagt Morsch. Aber man dürfe sie auch nicht als Topfdeckel nehmen, in den man die Gegenwart hineinpresse. Morsch formuliert es so: „Wer die Geschichte nur als ein Instrument von aktueller Politik begreift und nicht nach historischen Ursachen und Zusammenhängen fragt, der kommt erst gar nicht darauf, bestimmte Fragen an die Gegenwart zu stellen.“