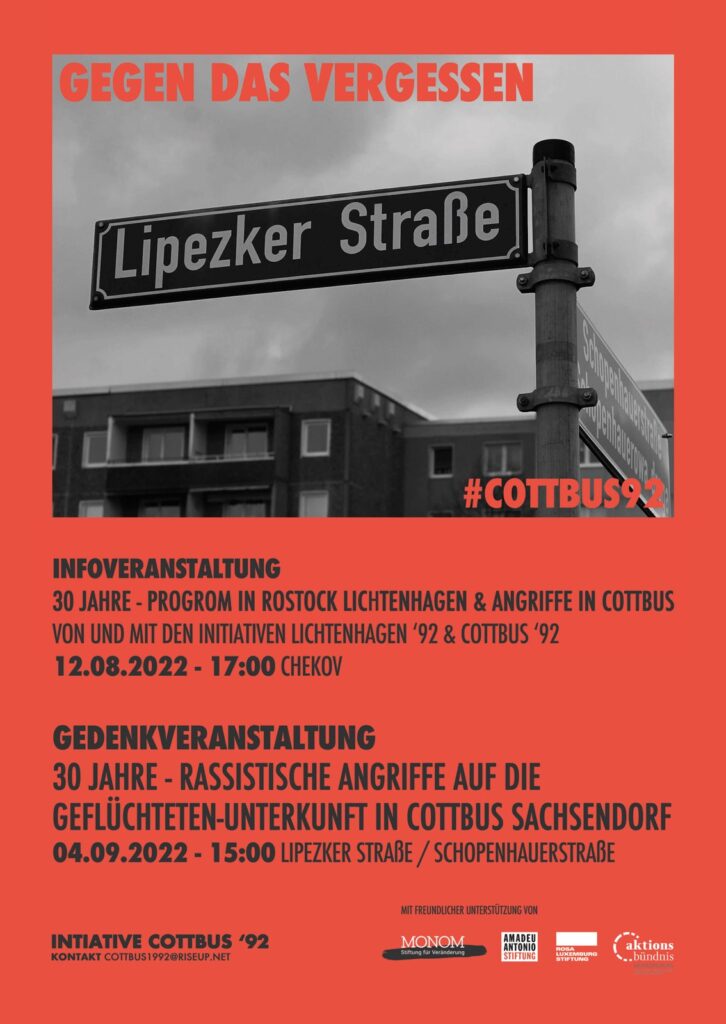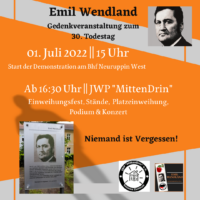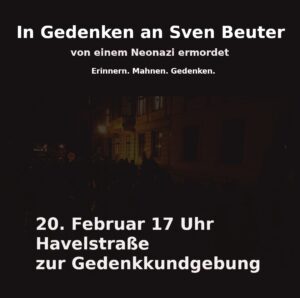Fast fünf Jahre nach dem Baustart der Förderruine Garnisonkirche wird uns nun der Prozess gemacht. Irgendwann nach der 5. Verschiebung des Prozesses habe ich aufgehört zu zählen, wie oft das Gericht mir einen Brief nach Hause schickte, um mal wieder anzukündigen, dass der Prozess verschoben werden müsse. In den schwersten Lockdown-Zeiten waren ein bis zwei Ausfälle verständlich, jedoch entwickelte sich das Absagen des Prozesses zum System und die Gründe wurden immer lächerlicher. Der beste Grund für eine Verschiebung war – wörtlich zitiert – „Dienstliche Gründe“ – ohne Angabe weiterer Erklärungen. Würde ich – als Betroffener – einfach mal aus „dienstlichen Gründen“ die Teilnahme an einem Gerichtsprozess abblasen, ohne weitere Belege einzureichen, drohten mir sofort Bußgelder. Für das Personal des Amtsgerichts drohen dagegen keine Konsequenzen. Stattdessen wurde mit jedem neuen Brief die ellenlange Zeug*innen-Liste mit 16 Personen angeheftet und an den zwei angesetzten Prozesstagen festgehalten. Es ist schon etwas verwirrend: Auf der einen Seite mit großen Tamtam und Zeug*innen-Liste dick auftragen und so tun, als ob es hier um einen wichtigen Prozess gehen würde und auf der anderen Seite dieses ständige Absagen und Verschieben. Ich muss zugeben, es nervt, fast fünf Jahre so hingehalten zu werden, während die Kosten für den Anwalt nicht geringer werden. Auch wenn es unter dem Strich einen gewissen Unterhaltungsfaktor bringt. Das ist so ähnlich wie bei den Durchsagen der Deutschen Bahn. Verspätungen sind äußerst nervig, aber es ist auch ein bisschen witzig, wenn mal wieder die alte liebe „Gleisstörung“ in der Ausreden-Lotterie gewonnen hat.
Große Ankündigungen mit viel Tamtam, etliche Male des Verschiebens, Raushauen von Steuergeldern ohne Sinn – das kennen wir auch bei dem gescheiterten Garnisonkirchenprojekt, um das es hier eigentlich gehen sollte. Wir erinnern uns: 2005 wurde der Grundstein für den Baustart gelegt. Danach passierte erst mal nichts. Auffällig war, dass mit jeder Bekanntgabe einer großen öffentlichen Förderung ein Baustart verkündigt wurde, der dann nicht kam und wieder um Jahre verschoben wurde. Erst mit der Millionen-Förderung der Bundesregierung konnte der Baustart im Jahr 2017 vollzogen werden. Im Nachhinein bewertet der Bundesrechnungshof die Förderung durch den Bundeshaushalt als nicht zulässig: Ein Projekt darf gemäß Bundeshaushaltsordnung nicht gefördert werden, wenn die Gesamtfinanzierung nicht nachgewiesen werden kann. Eine Gesamtfinanzierung war in weiter Ferne und nie greifbar. Seit der Grundsteinlegung ist es der Garnisonkirchenstiftung nie gelungen, substanziell Spenden einzunehmen. Statt ehrlich zum Scheitern der Spendensammlung zu stehen und das Projekt einzustampfen, griff die Stiftung zu einem Trick und labelte den 1. Bauabschnitt, den heute sichtbaren Turmstumpf, zu einem vermeintlich für sich stehendes Gesamtprojekt um. Nach Außen hat die Garnisonkirchenstiftung weiterhin kommuniziert, dass sie das Projekt erst umgesetzt sehen, wenn die gesamte Kirche steht. Ein Turmstumpf war für die Stiftung somit nie eine Option, nur Mittel zum Zweck, den Nachweis einer Gesamtfinanzierung zu simulieren. Im Übrigen ging noch nicht mal diese Rechnung auf, so dass der Bund auch schon für den 1. Bauabschnitt, den Turmstumpf, viele Millionen nachschießen musste. Man hat bewusst in Kauf genommen, dass der öffentliche Finanzgeber – entgegen seiner eigenen Regularien – bis zum Ende komplett alles bezahlt, damit keine Bauruine entsteht.
Das alles können wir Betrug nennen.
Und dabei ist das nicht alles: Die Garnisonkirchenstiftung und die Fördergesellschaft für den Wiederaufbau stehen auch noch im Verdacht, in einem Mio.-schweren Korruptionsfall verwickelt zu sein. Die finanzielle Förderung von mehr als 2 Mio. Euro durch das Land Brandenburg im Jahr 2010/11 ist unter zwielichtigen Umständen zustande gekommen ist: Gabriele Förder-Hoff, die damalige Referatsleiterin und Beauftragte des Haushalts im Ministerium für Wissenschaft Forschung und Kultur des Landes Brandenburg war mutmaßlich damals mitverantwortlich für die Freigabe dieser Fördermittel an die Garnisonkirche. Jedoch war Frau Förder-Hoff zu dieser Zeit gleichzeitig im Vorstand der Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche und dort zuständig für die Finanzen! Die damalige Förderung war höchst umstritten, da die Landesmittel normalerweise für Gedenkstätten bereitstehen sollten. Frau Förder-Hoff und ihre Fördergesellschaft für den Wiederaufbau haben sicher über diesen Coup gefreut. Wenn das nicht Korruption ist!
Für mich war die Ankündigung des damaligen Staatsministers der Bundesregierung für Kultur und Medien, Bernd Neumann, wohl gemerkt kurz vor Aufgabe seines Amtes, dem Garnisonkirchenprojekt 12,4 Mio. Euro zu verschaffen, der entscheidende Impuls, in den aktiven Widerstand gegen die Garnisonkirchenkopie zu gehen. Zugegeben, es gibt wichtigere Dinge, als reiche Leute davon abzuhalten, mit Steuergeldern ihre sinnlosen Puppenhäuser zu bauen. Das damalige Mio.-Versprechen war jedoch ein großer Durchbruch für das Projekt. Wir in Potsdam mussten nun wirklich befürchten, dass hier ein städtebaulich dominanter Symbolbau auf Mio.-Kosten der Öffentlichkeit entsteht. Insgesamt kalkulierte man mit über 100 Mio. Euro für den Gesamtbau. Jahrelang versprach die Stiftung, dass ihr Privatvergnügen zu 100% durch Spenden finanziert wird. Das war eindeutig eine bewusste Täuschung, um politisch die entscheidende Zustimmung zu bekommen, auf die immer wieder verwiesen wird, um sich Kritik vom Hals zu halten. Denn bereits Ende 2004 hätte den Beteiligten klar sein müssen, dass die Spendenfinanzierung eine Illusion ist. Nach intensiven Beratungen lehnte es der damalige Vorstandssprecher der Commerzbank, Klaus Peter Müller, gegenüber Wolfgang Huber, Matthias Platzeck und Jörg Schönbohm ab, als Stifterbank zu fungieren, da „die Aussichten auf ein hohes Spendenaufkommen derzeit negativ zu beurteilen sind. Auch die immer noch beachtliche Bereitschaft der deutschen Bevölkerung, Spendenaufrufe zu folgen, zeigt deutlich, dass soziale Projekte und Katastrophen-Hilfe absolute Priorität genießen.“ Diese realistische Einschätzung bewahrheite sich in den folgende Jahren, ohne dass die Initiatoren daraus die nötigen Konsequenzen zogen.
Die betrügerischen Tricks bei der Simulierung einer Gesamtfinanzierung, um an öffentliche Gelder zu kommen, und die bewusste Spendenlüge, um politische Zustimmung zu erlangen, sind nur zwei Beispiele davon, dass die evangelische Kirchenstiftung und ihre Protagonisten wie, Wolfgang Huber, Wieland Eschenburg, Martin Vogel, Peter Leinemann, Cornelia Radeke-Engst christliche Werte offensichtlich missachten. Das einfache Gebot „Du sollst nicht lügen“ steht im klaren Kontrast zu dem, was wir bisher bei dem Bauprojekt erleben durften.
Für mich gipfelte die Missachtung von christlichen Werten in der Inszenierung eines Gottesdienstes am 11.09.2016, als ZDF-Gottesdienst, um eine Werbeshow für den Wiederaufbau der Garnisonkirche zu veranstalten. Das war für mich das Zeichen, dass die Garnisonkirchenstiftung samt ihrer Pfarrerin Cornelia Radeke-Engst keine Scheu haben, christliche Rituale zu missbrauchen, um ein städtebauliches Projekt im Gewand des 18. Jahrhunderts zu promoten.
Dass dieser Missbrauch besonders mir aufstößt, liegt in meiner christlichen Erziehung begründet. Ich bin in einer christlichen Familie mit gläubigen Eltern aufgewachsen. Christliche Werte stellten meinen Kompass dar. Was ich früher gelernt und heutzutage auch immer noch verinnerlicht habe, sind Ehrlichkeit, Nächstenliebe, Gerechtigkeit und Genügsamkeit – all diese Werte stehen im krassen Gegensatz zu dem Treiben des Garnisonkirchenprojektes. Die Bibel ist voll mit Geschichten, in denen der Hochmut – wie sie die Garnisonkirchenstiftung an den Tag legt — gegeißelt wird – angefangen vom Turmbau zu Babel bis zum Pharisäer, der auf arme Leute herabschaut und sich an seiner vermeintlichen Religiosität ergötzt.
Ich war jedoch nicht der einzige, der über diese Skrupellosigkeit der Garnisonkirchenstiftung, christliche Fundamente zu instrumentalisieren, geschockt war. Für den Architekten Philipp Oswalt war der ZDF-Gottesdienst der Anlass, aus der Evangelischen Kirche mittels eines öffentlichen Briefes an die EKD auszutreten. Er schrieb „Beim Gottesdienst ging es – abgesehen von ritualisierten Redewendungen – ohnehin nicht um Frieden und Versöhnung, sondern darum, vor dem Fernsehpublikum für den Wiederaufbau zu werben. Und dabei knüpfte man an die Tradition der Garnisonskirche als Staats- und Militärkirche an. Neben den zwei Geistlichen sprachen in dem 45 minütigen Gottesdienst zwei Politiker und ein Bundeswehroffizier in Zivil.“ Weiter schreibt er: „Die Idee von Frieden und Versöhnung wird nicht nur instrumentalisiert, sie wird auch konterkariert. Denn man nimmt mit dem Vorhaben bewusst in Kauf, in Stadt und Kirche Unfrieden zu stiften.“
Dass sie für die Bewerbung eines städtebaulichen Projektes nicht nur ihre eigenen Gottesdienste missbrauchen, sondern auch Begriffe wie Versöhnung gezielt zur Immunisierung gegen Kritik nutzen, zeigt ihre Unverfrorenheit, nicht nur christliche, sondern auch demokratische Werte zu hintertreiben. Denn während ein großer Teil der Potsdamer Bevölkerung in unzähligen Bürgerhaushaltsabstimmungen und schließlich im erfolgreichen Bürgerbegehren gegen die Garnisonkirche ihren Widerstand gegen dieses Projekt immer wieder zum Ausdruck brachte, blockt die Garnisonkirchenstiftung jegliche Kritik an dem Nachbau der originalen Fassade und Silhouette ab, mit dem Hinweis, dass sie Versöhnung und damit gute Arbeit betreiben und die Kritik der Gegner*innen damit ins Leere laufen würde. Diese Arroganz und anti-basisdemokratische Ignoranz spürte ich besonders als Hauptkoordinator und Vertrauensperson für das Bürgerbegehren zur Auflösung der Garnisonkirche im Jahr 2014 am eigenen Leib. An der Stiftung und der Evangelischen Kirche perlte das Bürgerbegehren ab, dabei haben 14.285 Potsdamer*innen gültig unterschrieben – weit mehr als die CDU oder die Grünen Stimmen bei Potsdamer Kommunalwahlen bekommen. Ihre propagierte Versöhnung gilt offensichtlich nicht den Menschen. Demokratie ist für die Garnisonkirchenstiftung nur insoweit wichtig, solange die Institutionen Steuergelder für ihre Luxuskirche organisieren. Ich möchte ein weiteres Beispiel von vielen aufführen, das zeigt, wie sehr die Demokratieverachtung seitens der Garnisonkirchenstiftung ausgeprägt ist. Am 23.06.2018, am 50. Jahrestag der Sprengung der GK-Ruine veranstaltete die Garnisonkirchenstiftung eine Veranstaltung in der Nagelkreuzkapelle. Hierfür meldete sie auf öffentlichen Grund u.a. im Bereich der Werner-Seelenbinder-Straße eine Veranstaltung an und sperrte diesen Bereich mit Flatterband ab – obwohl die Veranstaltung gänzlich im Gebäude der Nagelkreuzkapelle stattfand – somit war die Veranstaltungsanmeldung für den Bereich draußen ein Trick, um mittels einer Art Bannmeile die Gegner*innen des Wiederaufbaus weiträumig auf Distanz zu halten. Dabei wollte lediglich eine Handvoll Personen von der Bürgerinitiative vor dem Eingang der Veranstaltung – jedoch auf öffentlichem Grund – Flyer an die Veranstaltungsteilnehmer*innen verteilen. Als sich die BI-Mitglieder nicht von diesen Einschüchterungsversuchen beeindrucken ließen, rief Peter Leinemann, Geschäftsführer der Stiftung, sogar die Polizei, die mit rund 20 Beamt*innen, anrückte. Die Polizei wies jedoch Peter Leinemann zurecht, dass er hier missbräuchlich Hausrecht für einen öffentlichen Grund anwendete und kein Recht hat, andere Personen von öffentlichem Grund wegzuschicken. Man könnte meinen, dass die Garnisonkirchenstiftung an ihrem selbsternannten Versöhnungsort demokratische Prinzipien respektieren und sich mit der Kritik auseinandersetzen sollte statt diese zu verbannen.
Diese Widersprüche und Verlogenheit könnten ja noch verschmerzbar sein, wenn die Evangelische Kirche ein kleines Projekt betreiben würde und damit irrelevant für die Stadtentwicklung in Potsdam wäre. Aber leider ist das nicht der Fall. Das Garnisonkirchenprojekt ist ein städtebaulich höchst folgenreiches Projekt. Es steht viel auf dem Spiel: Die weitere Verschwendung von öffentlichem Geld, die Vernichtung von bisher günstigen Räumen für Kunst und Kultur im Rechenzentrum, der von Mitteschön geforderte Abriss eines Teils des Studierendenwohnheims zur Errichtung eines historischen Stadtplatzes neben der Garnisonkirche und das Risiko der Garnisonkirchenkopie, zu einem Symbolort für die neue Rechte und zu einer geschichtspolitischen Propagandashow der Bundeswehr zu werden.
Und es ist auch keine gute demokratische Praxis, basisdemokratische Voten wie das Bürgerbegehren zu übergehen, wenn es sich um den Bau des höchsten Gebäudes Potsdams handelt. Nicht jede*r in Potsdam ist – wie Mitteschön und die Garnisonkirchenstiftung– in ästhetischer Hinsicht im 18. Jahrhundert stecken geblieben.
Der Umgang mit dem Ort der ehemaligen Garnisonkirche ist mitnichten ein privates Bauprojekt. Dass es hier um ein Städtebauprojekt handelt, ist auch der evangelischen Kirche klar: Das zeigt sich u.a. bei der Nagelkreuzkapelle. Diese besitzt noch nicht einmal eine Personalgemeinde. Das heißt, sie hat keinen eigenen Gemeinde-Stadtteil zugeordnet wie es normalerweise für Gemeinden der Fall ist. Es gibt schließlich keinen Bedarf an weiteren Räumlichkeiten – ganz zu schweigen von einer 100 Mio. Euro-Kirche – bei den Gemeinden und Kirchenmitgliedern in Potsdam.
Umso wichtiger ist es für uns als Öffentlichkeit, unser Recht auf Mitbestimmung bei dem folgenreichen Städtebauprojekt einzufordern. Wenn die Garnisonkirchenstiftung der Meinung ist, die Form von Gottesdiensten zu missbrauchen, um sich Protest vom Halse zu halten, ist das in erster Linie ihr Problem. Mir geht es ausschließlich um die Mitbestimmung an diesem Ort und nicht um die persönliche Ausübung des Glaubens.
Ich werde daher weiterhin von meinem Versammlungsrecht Gebrauch machen, um gegen diese gotteslästerliche Bude – wie der Theologe und ZEIT-Journalist Christoph Dieckmann die Garnisonkirche nennt – auf die Straße zu gehen.
Denn auch noch jetzt gibt es viele Möglichkeiten für die Evangelische Kirche reinen Tisch zu machen und das Projekt so zu transformieren, dass es tatsächlich ein Ort wird, an dem Geschichte angemessen erinnert werden kann, ohne Interessenkonflikte mit der Bundeswehr (die u.a. die geplante Dauerausstellung finanzieren soll…) und preußische Militarismus-Romantik.
Dafür ist es dringend notwendig, dass sich die Evangelische Kirche endlich verantwortlich zeigt und aus dem Projekt geordnet aussteigt:
• Sofortiger Stopp aller Planungs- und Baumaßnahmen an Turm und Kirchenschiff!
• Sofortige Einstellung jedweder öffentlicher Finanzierung!
• Kein Abriss des Rechenzentrums!
• Protest entkriminalisieren!
• Konversion und Teilrückbau der Bausubstanz zu einem öffentlichen Ort und Mahnmal der kritischen Auseinandersetzung mit der Geschichte und des Wiederaufbauvorhabens!
• Echte Mitbestimmung durch die Potsdamer Stadtgesellschaft beim Umgang mit dem Ort statt von einer kirchlichen Stiftung, Mitteschön und Bundeswehr diktierte Geschichtsklitterung!
• Auflösung der Stiftung Garnisonkirche! Personelle und rechtliche Konsequenzen für die Verantwortlichen der SGP!
In diesem Sinne können Sie, Frau Richterin, den Anfang machen, und diesen unwürdigen Prozess ein Ende bereiten und die Anklagen fallen lassen.
Vielen Dank!